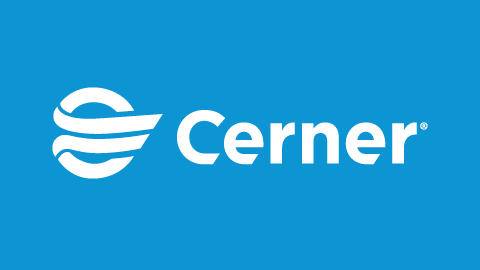Warum es für Leistungserbringer Sinn macht, jetzt im Schulterschluss mit den IT-Herstellern die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen
Die Situation im deutschen Gesundheitswesen ist paradox: Während sich die medizinische Versorgung in der internationalen Spitzenklasse wiederfindet, hinkt das Land bei der Digitalisierung nach wie vor hinterher. Obwohl der Wille da ist und hohe Summen in Projekte wie die Telematikinfrastruktur investiert werden, gelingt es nicht, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Länder wie Dänemark, Estland oder Schweden zeigen, dass IT im Gesundheitswesen wesentlich mehr ist als reiner Datentransfer. Sie gestalten nicht nur die medizinische Versorgung effizienter, sondern nutzen IT auch, um die Patienten enger in die Behandlung einzubinden – über Versorgungsgrenzen hinaus. Um auch das deutsche Gesundheitswesen in der Digitalisierung auf die vordersten Plätze zu bringen, sind Anwender und Hersteller gefragt. Sie müssen im Schulterschluss praxisgerechte Lösungen etablieren und auf die Lösung drängender Fragen, wie z. B. nach konkreten Handlungsrichtlinien im Datenschutz, insistieren.
Lesedauer des gesamten Beitrags ca. 8 Minuten. Lieber später in Ruhe lesen? Laden Sie HIER die PDF-Version herunter.
*************************************************************************
Wissen Sie, was ein Penrose-Dreieck ist? Es handelt sich dabei um eine nach dem britischen Mathematiker Sir Roger Penrose benannte, unmögliche geometrische Figur, bei der drei Balken scheinbar rechtwinklig miteinander verbunden sind und trotzdem ein Dreieck ergeben. Diese bildhafte Darstellung eines Paradoxons erinnert stark an das Gesundheitswesen in Deutschland: So stufte eine Studie der University of Washington in Seattle aus dem Jahr 2017 die medizinische Versorgung hierzulande auf einem respektablen 20. Platz von 195 untersuchten Ländern ein.[1]
Digitalisierung im Gesundheitswesen: guter Wille, schlechtes Ranking
Im DESI Report 2018, einer von der europäischen Kommission angefertigten Studie über die Nutzung digitaler Angebote, landet Deutschland im Hinblick auf die Nutzung digitaler Gesundheitsangebote auf Platz 26 – allerdings wurden hier nur die 28 Länder der Europäischen Union bewertet. Für Optimisten mag es ein Trost sein, dass wir bei der patientenorientierten Anwendung von Healthcare IT immerhin gleichauf mit Ungarn und noch vor Malta liegen. Realistisch betrachtet sollte es allerdings mehr als nachdenklich machen, wenn die Industrienation Deutschland in einem derart wichtigen Bereich deutlich hinter Ländern wie Rumänien oder dem schuldengeplagten Griechenland herhinkt.
An mangelndem Willen liegt es jedenfalls nicht. Seit Jahrzehnten fließen Unsummen in die Entwicklung einer Telematikinfrastruktur und wird regelmäßig die Wichtigkeit von IT-Lösungen im Gesundheitswesen beschworen. Nur kommt davon offenbar so gut wie nichts bei denen an, um die es eigentlich geht: bei den Patienten.
Was Medizinsoziologie mit Healthcare IT zu tun hat
Um zu verstehen, warum dies so ist, sollte man sich die Frage stellen, was eigentlich die Anforderungen an eine moderne Gesundheits-IT sind. Man muss nicht ins Detail gehen, um zu erkennen, dass das eigentliche Problem der Healthcare IT in Deutschland seine Wurzel genau darin hat, dass man es bislang versäumte einer seit den 1990er Jahren an Fahrt gewinnenden Entwicklung Rechnung zu tragen: dem zunehmenden Bedürfnis der Patienten, aktiv in den Behandlungsprozess eingebunden zu werden.
In den 1950er Jahren beschrieb der Begründer der Medizinsoziologie Talcott Parsons die Rollen von Patient und Arzt als weitgehend getrennt. Dem Patienten als Laien wurden Subjektivität, mangelndes Wissen und vorrangig Krankheitserleben zugestanden. Gleichzeitig wurde der Arzt als objektivierende, auf mess- und definierbaren Grundlagen handelnde, professionell denkende Person gesehen. Diese Sichtweise änderte sich ab den 1970er Jahren: Der Status des Patienten – als letztlich Betroffener – wandelte sich zunehmend vom passiv-erduldenden Charakter zum aktiv-gestaltenden Partner des Arztes. Die rasant wachsende Möglichkeit, leicht an Informationen zu gelangen, die sich ab den späten 1980er Jahren durch die Verbreitung des Internets entwickelte, tat ein Übriges. Ende der 1990er Jahre gab es erste Bestrebungen auf politischer Ebene, dem Patienten mehr Mitwirkung an seiner Behandlung zu ermöglichen und ihm mehr Rechte zu geben. In der Folge wurde diese Entwicklung durch verschiedene Gesetze immer weiter vorangetrieben.
Von Wunsch und Wahrheit
Das Bundesgesundheitsministerium formulierte 2011 als nationales Gesundheitsziel[2] u.a., dass das „Ziel der Erhöhung gesundheitlicher Kompetenzen und der aktiven Beteiligung von betroffenen Patienten und Bürgern … die positive Veränderung des Gesundheits- und Krankheitsverhaltens, die Förderung der Prävention und somit die Verbesserung der Behandlungserfolge“ sei. Vor diesem Hintergrund wirkt es geradezu paradox, dass die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bei eben dieser Beteiligung und Umsetzung der Ziele bieten würde, nach wie vor nur marginal genutzt werden.
Eine unmittelbare, aktive Beteiligung am Behandlungsprozess ist den Patienten auch nach gut sieben Jahren weiterhin kaum möglich. Stattdessen beschränkt man sich auf unterschiedliche passive Maßnahmen, beispielsweise „zielgruppengerichtete Gesundheitsinformationen und Beratungsangebote“, oder „Krankenhaus-, Arztsuch- und Arztbewertungsportale“ und verschleißt sich seit Jahrzehnten in einer Telematikinfrastruktur. Diese – so ist auf der Website der gematik[3] zu lesen – „… vernetzt alle Akteure des Gesundheitswesens im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung und gewährleistet den sektoren- und systemübergreifenden sowie sicheren Austausch von Informationen. Sie ist ein geschlossenes Netz, zu dem nur registrierte Nutzer (Personen oder Institutionen) mit einem elektronischen Heilberufs- und Praxisausweis Zugang erhalten.“
Anders gesagt: Der Patient muss draußen bleiben. Er hat allenfalls ein Auskunftsrecht über seine gespeicherten Daten. Informationen, die durch ihn geliefert werden, können und müssen durch den Arzt eingegeben werden. Unwillkürlich denkt man an die weiter oben erwähnten medizin-soziologischen Betrachtungen Parsons: Die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens befindet sich vom Denkansatz her immer noch in den 1950er Jahren.
Was machen Länder in Spitzenpositionen anders?
Zwar existieren vereinzelt Möglichkeiten des Telemonitorings oder telemedizinischer Leistungen. Allerdings ist man in Deutschland weit davon entfernt, derartige Leistungen flächendeckend anbieten zu können. Ein wesentlicher Grund dürfte die fehlende Interoperabilität sein. Länder wie Estland, Dänemark oder Schweden, die in der Digitalisierung des Gesundheitswesens führend sind, geben gesetzlich festgeschriebene Standards zur Systeminteroperabilität vor. Auf diese Weise verknüpft man dort recht problemlos eine Vielzahl an Lösungen für verschiedene Anwendungsszenarien.
So steht in Dänemark z. B. neben Anwendungen zum häuslichen Monitoring bereits seit den 1990er Jahren ein auch für Patienten zugängliches Gesundheitsportal zur Verfügung (www.sundhed.dk). In Estland besitzen rund 98 Prozent der Einwohner eine elektronische Gesundheitsakte. Auch das eRezept ist dort bereits flächendeckend umgesetzt.
Offene Strukturen für mehr Patientenbeteiligung
Dabei bietet gerade eine Öffnung der Infrastrukturen die Möglichkeit, Patienten wirklich an ihrer Behandlung zu beteiligen und gleichzeitig auch das Gesundheitswesen zu entlasten. Der Bedarf seitens der Patienten ist da: Eine mehr oder weniger unkontrollierte Flut an Gesundheits-Apps ist mittlerweile auf dem Markt erhältlich. Man kann nun über Daten- und Anwendungssicherheit lamentieren oder schlicht gesetzliche Grundlagen schaffen, auf deren Basis Gesundheits-Apps nicht nur vertrieben, sondern auch zertifiziert und in eine digitale Gesundheitsinfrastruktur eingebunden werden. Die Anwendungsszenarien reichen von einer Überwachung chronisch kranker Patienten bis hin zu echter Gesundheitsvorsorge. Zumindest dann, wenn die Möglichkeit besteht, dass patientenorientierte Lösungen und professionelle Anwendungen miteinander interagieren und Daten miteinander austauschen und diese ausgewertet werden können.
Gesetzliche Grundlagen sollten dabei Sicherheit geben, nicht verwirren. Unklarheit, wie sie zum Beispiel bei der Anwendung der Medizinprodukterichtlinie auf Krankenhausinformationssysteme immer noch existiert, ist weder im Sinne der Versorger noch der Patienten, um die es eigentlich gehen sollte. Es ist an der Zeit, dass der Patient im Gesundheitswesen wirklich in den Mittelpunkt rückt.
Flächendeckende, offene IT-Infrastrukturen sind auch eine Frage von Patientensicherheit und Qualität
Dazu gehört, dass sich in deutschen Krankenhäusern die Digitalisierung auch im medizinischen Bereich endlich flächendeckend durchsetzt. Während der Abrechnungsbereich bereits weitgehend digitalisiert ist und ICD, OPS und DRG munter über die Datenautobahn laufen, arbeitet der überwiegende Teil deutscher Kliniken in der medizinischen Dokumentation noch auf Papierbasis. Und selbst wenn Informationen in digitaler Form vorliegen, dann häufig so, dass Dokumente schlicht gescannt und im Ganzen in den Systemen gespeichert werden. Die in den Dokumenten enthaltenen Daten können auf diese Weise nicht analysiert und weiter genutzt werden. Im Zweifelsfall ist die IT so „blind“ für wichtige Informationen. Das geht auch auf Kosten der Patientensicherheit: Systeme zur Früherkennung von Hygieneproblemen und zum Infektionsmanagement beispielsweise benötigen lesbare elektronische Daten aus verschiedenen Bereichen.
Hinzu kommt, dass jeder, der schon einmal in der Patientenversorgung gearbeitet hat, weiß, dass ein Krankenhausaufenthalt nur ein kleiner Ausschnitt aus der Geschichte des Patienten ist. Im Behandlungskontext müssen viele Informationen erst mühsam gewonnen werden. Keine leichte Übung, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass die Verweildauern mittlerweile auf ein Minimum zusammengeschrumpft sind. Gerade bei chronisch kranken Patienten gewinnt der Krankheitsverlauf aber an Bedeutung.
Anders gesagt: Während die Anforderungen an eine moderne Diagnostik und Therapie schon längst althergebrachte Versorgungsgrenzen sprengen und IT dieser Entwicklung Rechnung trägt und sie unterstützen könnte, arbeiten Ärzte und Therapeuten vielfach noch wie zu prädigitalen Zeiten.
Kostenreduktion durch vermeidbare Krankenhausaufenthalte
Dabei würde eine für alle – also auch Patienten – flächendeckend zugängliche Infrastruktur nicht nur die Arbeit der Leistungsanbieter wesentlich vereinfachen, sondern auch die Qualität der Versorgung bei gleichzeitiger Kostenreduktion steigern. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Versorgung von psychiatrischen Patienten. Viele von ihnen gelten als chronisch krank und benötigen eine eng abgestimmte, mal mehr, mal weniger intensive Unterstützung bzw. Therapie. In den aktuell vorherrschenden Strukturen bleibt Patienten oft nichts anderes übrig, als sich in ein Fachkrankenhaus einweisen zu lassen oder sich in einer Notaufnahme vorzustellen. Dabei würde oft eine Begleitung oder weniger invasive Therapie im häuslichen Umfeld ausreichen. Insbesondere vor dem Hintergrund der an- stehenden Änderung der Finanzierung in der Psychiatrie wären hier deutlich besser vernetzte, Versorgungsgrenzen übergreifende, IT-unterstützte Strukturen sinnvoll und wünschenswert. In Pilotprojekten zeichnet sich ab, dass das dazu führen würde, Patienten wesentlich zielgerichteter, engmaschiger und ressourcenschonender begleitet zu können. Es bedarf nicht viel Vorstellungskraft, um zu erkennen, dass das analog durchaus auch für weite Bereiche der somatischen Medizin gelten dürfte. Es verwundert vor diesem Hintergrund nicht, dass in einem hochdigitalisierten Gesundheitswesen wie in Dänemark die Verweildauern etwa im Universitätsklinikum von Odense mittlerweile deutlich unter drei Tagen liegen.
Die technologische Basis der Healthcare IT muss flexibler werden
Mit dem Aufbau einer neuen IT-Infrastruktur alleine ist es jedoch nicht getan. Auch bereits bestehende Lösungen müssen technologisch den neuen Anforderungen angepasst werden. Die in vielen Ländern innerhalb und außerhalb Europas sichtbare Tendenz des versorgungsgrenzenübergreifenden Austauschs von Daten, mit und über den Patienten, wird mit den bisherigen On-Premise-Systemen kaum gestaltbar sein. Die sichere Kommunikation zwischen einzelnen Systemen ist dabei – ob mit oder ohne Telematikinfrastruktur – nicht der ausschlaggebende Faktor. Vielmehr ist es so, dass Leistungserbringer zukünftig neben einem Basissystem für die grundlegenden Funktionalitäten zunehmend schlanke Speziallösungen an ihre Kernlösung anbinden werden. Knackpunkte dabei sind Interoperabilität und Kosteneffizienz.
Zumeist ist es bisher üblich, Speziallösungen von Drittanbietern mit aufwendigen und teuren Schnittstellen an Kernsysteme anzubinden und somit im schlechtesten Fall, z. B. aufgrund unterschiedlicher Dateiformate oder Schnittstellenstandards, nur einen eingeschränkten Datenaustausch zu verwirklichen. Die Zukunft hingegen liegt in IT-Ecosystemen, bestehend aus einer Plattform mit Kernanwendungen. An diese können vom Plattformanbieter zertifizierte Anwendungen, die von Lösungsanbietern bzw. freien Entwicklern programmiert werden, über klar definierte und standardisierte Schnittstellen angebunden werden. Im Rahmen derartiger Vorgaben könnten dann auch zertifizierte Patienten-Apps dazu dienen, behandlungsrelevante Informationen zu sammeln und zu übermitteln. So würden beispielsweise regelmäßig vom Patienten gemessene Werte über Blutdruck oder Blutzucker endlich dorthin kommen, wo sie eigentlich hingehören: als detaillierte Verlaufsdokumentation in die Patientenakte. Auch die Kommunikation von Ärzten und Patienten kann auf diese Weise verbessert werden: Schon heute existieren Anwendungen, die es Krankenhäusern ermöglichen, vor und nach stationären Aufenthalten Informationen wie z. B. Aufklärungsbögen oder Assessments mit ihren Patienten elektronisch auszutauschen.
Auf diese Weise wird die nächste IT-Generation im Gesundheitswesen endlich Realität: schlanke Kernsysteme, die mit geringen Mitteln durch Apps ergänzt werden, die genau auf die Bedürfnisse der Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Wie in anderen Bereichen werden sich auch im Gesundheitswesen deswegen über kurz oder lang eher cloud-basierte Lösungen durchsetzen. Auch wenn verständlich ist, dass viele Verantwortliche in Krankenhausleitung und IT sich aus grundsätzlichen Datenschutzbedenken noch gegen diese Entwicklung sträuben: Der Blick über die Landesgrenzen zeigt, dass sie nicht mehr aufzuhalten ist und dass sie die Patientenversorgung große Schritte nach vorne bringt.
Gemeinsam Lösungen entwickeln statt Innovation zu blockieren
Anstatt sich gegen diese unabwendbare technologische Entwicklung zu stemmen, ist es sinnvoll, sie gemeinsam mit den IT-Anbietern und den Datenschützern zu gestalten. Jetzt! Denn die technologische Entwicklung hat schon längst Fahrt aufgenommen: Krankenkassen führen eigene elektronische Patientenakten ein, um ihren Kunden die Möglichkeit zu geben, relevante Gesundheitsdaten zu sammeln und zu teilen. Krankenhäuser nutzen Apps, um prä- und poststationär mit ihren Patienten Informationen zu teilen und sie bestmöglich zu informieren. Und in ersten Pilotprojekten werden Public-Health-Lösungen angedacht und geplant. Wenn Deutschland sich nicht endgültig im Bereich Healthcare IT auf den hintersten Plätzen von Rankings häuslich einrichten möchte, müssen die Entscheidungsträger in der Politik endlich aufhören, in kleinteiligen Lösungen wie der Telematikinfrastruktur zu denken, die allenfalls den Verwaltungsprozess verbessern. Vielmehr geht es darum, großzügige, dennoch klare Rahmenbedingungen abzustecken, innerhalb derer sich Anwender und Hersteller von Healthcare IT frei bewegen und entfalten können, sowie auch die Finanzierung der notwendigen Infrastrukturen sicherzustellen.
Leistungserbringer und Hersteller – ein starkes Team
Die Leistungserbringer sind gefordert, jetzt zusammen mit den Herstellern von Healthcare IT die nächsten Schritte in Richtung moderner Lösungen zu gehen. Dazu gehört auch, im Zweifelsfall – gerade im Hinblick auf den Datenschutz – Fragen aufzuwerfen und bei den politischen Entscheidungsträgern und Datenschutzbehörden auf deren Beantwortung zu insistieren, um endlich Handlungssicherheit zu bekommen. Die technologischen Möglichkeiten sind da. Allerdings befinden sich viele Leistungserbringer in der Zwickmühle, dass sie zu Einsparungen gezwungen werden, die Investitionen in Healthcare IT erfordern, für die die Mittel nicht zur Verfügung stehen. Das ist das eigentliche Penrose-Dreieck im deutschen Gesundheitswesen.
Umso wichtiger ist es, dass Leistungserbringer und IT-Hersteller gemeinsam Lösungen finden, um jetzt die Weichen für moderne IT-Infrastrukturen im Gesundheitswesen zu stellen. Ansonsten wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis wir Ungarn und Malta im nächsten Ranking nur noch von hinten sehen.
Fotos: © iStock